
Der Preis auf einer Auktion ist kein reines Ergebnis von Angebot und Nachfrage, sondern eine sorgfältig inszenierte psychologische Darbietung.
- Schätzpreise und Limits sind strategische Anker, keine reinen Wertangaben, die die Wahrnehmung der Bieter gezielt steuern.
- Das Bietergefecht wird von kognitiven Fallen wie dem „Fluch des Gewinners“ bestimmt, die zu irrationalen und überhöhten Geboten führen können.
- Der Hammerpreis ist nur die halbe Wahrheit; das Aufgeld, Steuern und Folgerecht verändern die Gesamtkalkulation fundamental.
Empfehlung: Erkennen Sie die Spielregeln und agieren Sie mit strategischer Gelassenheit, statt sich von der emotionalen Dynamik des Saals mitreissen zu lassen.
Der Saal ist still. Alle Augen sind auf den Auktionator gerichtet, der mit gehobenem Hammer den nächsten Zuschlag ankündigt. Die Luft knistert vor Spannung. Vielleicht haben Sie diese Szene schon einmal selbst erlebt, sei es als potenzieller Käufer mit einem begehrten Objekt im Visier oder als Einlieferer, der hofft, den bestmöglichen Preis für sein Kunstwerk zu erzielen. In diesen Momenten fühlt sich die Preisbildung oft wie ein undurchschaubares Mysterium an, ein emotionales Auf und Ab, das von Zufällen und der Laune einzelner Bieter regiert wird. Man rät Ihnen, ein Limit zu setzen, einen kühlen Kopf zu bewahren und gut zu recherchieren. Das sind zweifellos vernünftige Ratschläge, doch sie kratzen nur an der Oberfläche.
Doch was, wenn ich Ihnen als erfahrener Auktionator verrate, dass dies alles Teil einer komplexen Choreografie ist? Der Preis, der am Ende unter dem Hammer erzielt wird, ist selten ein Zufallsprodukt. Er ist das Ergebnis eines fein austarierten psychologischen Spiels, in dem das Auktionshaus, der Einlieferer und die Bieter die Hauptrollen spielen. Die eigentliche Kunst liegt nicht darin, einfach nur ein Gebot abzugeben, sondern die ungeschriebenen Regeln und die kognitiven Mechanismen zu verstehen, die im Verborgenen wirken. Es geht darum, die strategische Bedeutung eines Schätzpreises zu entschlüsseln, die psychologischen Fallen eines Bietergefechts zu erkennen und die wahren Kosten nach dem Hammerschlag zu kalkulieren.
Dieser Artikel hebt den Vorhang und gewährt Ihnen einen Blick hinter die Kulissen deutscher Auktionshäuser. Wir werden die Preis-Choreografie von Anfang bis Ende analysieren: von der Festlegung des Limits über die Inszenierung im Katalog bis hin zur Dynamik im Auktionssaal. Ziel ist es, Sie vom passiven Zuschauer zum strategischen Akteur zu machen, der die Mechanismen nicht nur versteht, sondern sie für sich zu nutzen weiss.
Die folgende Gliederung führt Sie schrittweise durch die verschiedenen Akte dieses faszinierenden Schauspiels und stattet Sie mit dem nötigen Insiderwissen aus, um bei Ihrer nächsten Auktion souverän zu agieren.
Inhaltsverzeichnis: Die Psychologie hinter dem Hammerpreis
- Mehr als eine Schätzung: Die strategische Bedeutung von Schätzpreis und Limit bei einer Auktion entschlüsseln
- Der Rausch des Gefechts: Wie Sie im Bietkrimi einen kühlen Kopf bewahren und nicht zu viel bezahlen
- Im besten Licht: Wie Sie als Einlieferer dafür sorgen, dass Ihr Objekt zum Star des Auktionskatalogs wird
- Saal, Online oder Zeitauktion: Welcher Auktions-Typ für Ihr Objekt der richtige ist
- Der Preis nach dem Hammer: Warum das Aufgeld Ihre Auktionskalkulation komplett verändert
- Der Rausch des Gefechts: Wie Sie im Bietkrimi einen kühlen Kopf bewahren und nicht zu viel bezahlen
- Von „Los“ bis „Zuschlag“: Das Auktions-ABC für Einsteiger
- Der Preis der Schönheit: Wie sich Preise für Antiquitäten bilden
Mehr als eine Schätzung: Die strategische Bedeutung von Schätzpreis und Limit bei einer Auktion entschlüsseln
Für viele Neulinge ist der im Katalog abgedruckte Schätzpreis eine reine Wertangabe. Ein Trugschluss. In Wahrheit ist er eines unserer stärksten psychologischen Werkzeuge. Der Schätzpreis ist ein strategischer Anker. Er setzt einen Referenzpunkt im Kopf potenzieller Bieter und formt ihre Erwartungshaltung. Ein bewusst niedrig angesetzter Schätzpreis kann eine enorme Sogwirkung entfalten. Er signalisiert eine vermeintliche Chance und lockt eine breitere Bieterschaft an. Die Erfahrung zeigt: Lose ohne Mindestpreis erregen erhebliche Aufmerksamkeit und führen oft zu einem frühen und intensiven Bieterwettbewerb, der den Preis schnell in die Höhe treibt.
Während der Schätzpreis öffentlich ist, agiert das Limit – der mit dem Einlieferer vertraulich vereinbarte Mindestverkaufspreis – im Verborgenen. Es ist das Sicherheitsnetz des Verkäufers. Die Kunst für das Auktionshaus und den Einlieferer besteht darin, diese beiden Werte optimal aufeinander abzustimmen. Ein zu hohes Limit kann abschreckend wirken und Gebote von vornherein unterbinden. Ein zu niedriges Limit birgt das Risiko eines Verkaufs unter Wert. Manchmal wird sogar mit einem flexiblen Limit gearbeitet.
Fallstudie: Die strategische Preissenkung
Bei einer Auktion seltener Münzen lag der Mindestpreis bei 500.000 US-Dollar, doch die Gebote blieben aus. Der Auktionator senkte daraufhin strategisch das Limit auf 400.000 US-Dollar. Dieser Schritt weckte sofort neues Interesse, entfachte ein Bietergefecht und führte zu einem endgültigen Verkaufspreis von 650.000 US-Dollar. Diese Flexibilität zeigt, wie die Anpassung des Limits als taktisches Instrument genutzt werden kann, um eine festgefahrene Situation zu beleben und den Markt neu zu testen.
Für Sie als Einlieferer bedeutet das: Verhandeln Sie das Limit nicht nur basierend auf Ihrem Wunschpreis, sondern als strategisches Element. Ein Limit, das bei etwa 70-80 % des unteren Schätzpreises liegt, bietet oft den idealen Kompromiss aus Sicherheit und Anreiz für Bieter.
Der Rausch des Gefechts: Wie Sie im Bietkrimi einen kühlen Kopf bewahren und nicht zu viel bezahlen
Der Moment, in dem die Gebote schnell aufeinanderfolgen, ist der Kern des Auktionserlebnisses – und die gefährlichste psychologische Zone. Hier regieren nicht mehr nur rationale Abwägungen, sondern tief verankerte kognitive Verzerrungen. Das prominenteste Phänomen ist der sogenannte „Fluch des Gewinners“ (Winner’s Curse). Er beschreibt eine paradoxe Situation: Der Bieter, der den Zuschlag erhält, ist oft derjenige, der den wahren Wert des Objekts am stärksten überschätzt hat. Eine ökonomische Analyse bestätigt, dass der Meistbietende bei unvollständiger Information systematisch einen zu hohen Preis zahlt. Sie „gewinnen“ die Auktion, aber verlieren wirtschaftlich.
Dieses Phänomen wird durch den sozialen Druck im Saal und den reinen Wettbewerbsgedanken befeuert. Es geht nicht mehr nur um das Objekt, sondern darum, den anderen Bieter zu besiegen. Jedes weitere Gebot wird zu einer Investition in den bereits investierten Aufwand (Zeit, Recherche, Emotion), ein Trugschluss, der als „Sunk-Cost-Fallacy“ bekannt ist. Man will die bisherigen Mühen nicht „umsonst“ investiert haben und bietet weiter, obwohl das eigene Limit längst überschritten ist.
Die Konzentration, die Anspannung und der Wunsch zu siegen, spiegeln sich in den Gesichtern der Bieter wider. Es ist ein stiller, aber intensiver Kampf.
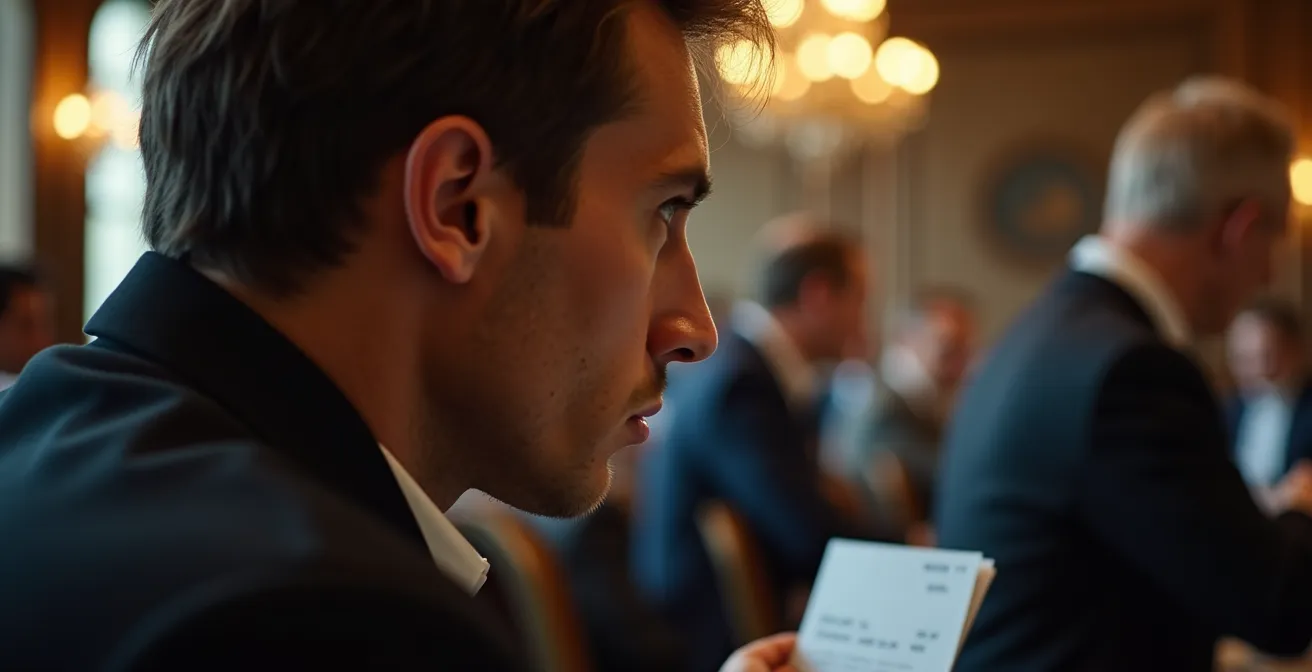
Wie Sie auf diesem Bild sehen, ist die Auktion ein hochkonzentrierter Prozess. Das Wissen um diese psychologischen Fallen ist der erste und wichtigste Schritt, um ihnen nicht zum Opfer zu fallen. Der kühle Kopf ist keine Charaktereigenschaft, sondern das Ergebnis strategischer Vorbereitung und des Bewusstseins für die eigenen emotionalen Triggerpunkte. Nur wer den Rausch des Gefechts als kalkulierbares Risiko begreift, kann ihn meistern.
Im besten Licht: Wie Sie als Einlieferer dafür sorgen, dass Ihr Objekt zum Star des Auktionskatalogs wird
Bevor der Hammer überhaupt gehoben wird, findet die erste, entscheidende Verkaufsphase statt: im Auktionskatalog. Hier wird die Begehrlichkeit eines Objekts geschaffen. Als Einlieferer haben Sie massgeblichen Einfluss darauf, ob Ihr Werk nur eines von vielen ist oder zum heimlichen Star der Auktion avanciert. Der Schlüssel dazu ist Storytelling. Ein Objekt mit einer fesselnden Geschichte erzielt fast immer einen höheren Preis als ein technisch vergleichbares Werk ohne narrative Aufladung.
Ihre Aufgabe ist es, uns als Auktionshaus die Bausteine für diese Geschichte zu liefern. Eine lückenlose und spannende Provenienz ist pures Gold. Woher stammt das Objekt? War es Teil einer bedeutenden Sammlung? Wurde es in einem renommierten deutschen Museum ausgestellt? Gerade bei Werken, die zwischen 1933 und 1945 entstanden sind oder den Besitzer wechselten, ist eine transparente und lückenlose Herkunftsgeschichte nicht nur wertsteigernd, sondern eine absolute Notwendigkeit. Anekdoten zur Entstehung, persönliche Verbindungen des Künstlers zum Werk oder eine prominente Vorbesitzerschaft schaffen eine emotionale Verbindung, die weit über technische Daten hinausgeht.
Manche Auktionshäuser nutzen sogar gezielt den emotionalen Hebel, um die Kaufbereitschaft zu erhöhen. Ein gutes Beispiel ist die Schaffung eines sozialen Mehrwerts.
Fallstudie: Der emotionale Kaufanreiz
Die Rotary Benefiz-Auktion in München bei Karl & Faber zeigt eindrücklich, wie emotionales Storytelling den Wert steigert. Durch das 50/50-Konzept, bei dem die Hälfte des Hammerpreises an soziale Projekte geht, wird der Kaufakt zusätzlich aufgeladen. Der Bieter erwirbt nicht nur ein Kunstwerk, sondern leistet gleichzeitig einen Beitrag für einen guten Zweck. Dieser „Feel-Good-Faktor“ kann die letzte Hürde nehmen und zu höheren Geboten motivieren.
Arbeiten Sie eng mit dem Experten des Auktionshauses zusammen. Liefern Sie ihm nicht nur das Objekt, sondern auch seine Seele. Eine packende Geschichte im Katalog ist die beste Versicherung für ein packendes Bietergefecht im Saal.
Saal, Online oder Zeitauktion: Welcher Auktions-Typ für Ihr Objekt der richtige ist
Die klassische Saalauktion mit einem Auktionator vor Publikum ist nur noch eine von mehreren Optionen. Die Wahl des richtigen Auktionsformats ist eine strategische Entscheidung, die vom Typ Ihres Objekts, dem Zielpreis und der gewünschten Bieterdynamik abhängt. Jedes Format hat seine eigene Psychologie und zieht unterschiedliche Käufertypen an. Als Einlieferer sollten Sie diese Unterschiede kennen, um gemeinsam mit dem Auktionshaus die beste Bühne für Ihr Objekt zu wählen.
Die Saalauktion bleibt die Königsdisziplin für hochkarätige und einzigartige Objekte wie Altmeistergemälde oder seltenes Meissener Porzellan. Hier entfaltet sich der soziale Druck und der Prestige-Effekt am stärksten. Gesehen und gesehen werden spielt eine Rolle, und die physische Präsenz der Konkurrenten kann die Gebote in die Höhe treiben. Bei Online-Auktionen, die oft parallel laufen, tritt der „Online-Disinhibitionseffekt“ auf: Anonym und vom heimischen Sofa aus geben Bieter manchmal leichter höhere Gebote ab. Dieses Format eignet sich hervorragend für Editionen, moderne Kunst und Objekte im mittleren Preissegment. Die Zeitauktion (Timed Auction) hingegen läuft über mehrere Tage und endet zu einem festen Zeitpunkt. Sie fördert die „Sniping-Strategie“, bei der Bieter erst in den letzten Sekunden ihr Höchstgebot abgeben, um Konkurrenten keine Zeit zur Reaktion zu lassen.
Interessanterweise ist die Zahl der registrierten Bieter nicht gleichbedeutend mit der Zahl der aktiven Teilnehmer. Eine Analyse deutscher Kunstauktionen zeigt, dass bei einer Auktion mit 100 registrierten Bietern oft nur etwa 30 aktiv mitbieten. Die Wahl des richtigen Formats hilft, die richtigen 30 Bieter zu mobilisieren.
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Unterschiede zusammen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen:
| Auktionsformat | Beste Objekttypen | Durchschn. Aufgeld | Psychologische Dynamik |
|---|---|---|---|
| Saalauktion | Hochwertige Gemälde, Meissener Porzellan | 25-30% | Sozialer Druck, Prestige-Effekt |
| Online-Auktion | Moderne Kunst, Editionen | 20-25% | Online-Disinhibitionseffekt |
| Zeitauktion | Mittleres Preissegment, Grafiken | 15-20% | Sniping-Strategie möglich |
Der Preis nach dem Hammer: Warum das Aufgeld Ihre Auktionskalkulation komplett verändert
„Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten!“ – der Hammerschlag besiegelt den Verkauf, doch der zugeschlagene Preis, der sogenannte Hammerpreis, ist für den Käufer noch lange nicht der Endpreis. Viele Bieter, die sich im Eifer des Gefechts hochgeboten haben, erleben nach der Auktion eine böse Überraschung. Die tatsächlichen Kosten liegen erheblich höher. Der entscheidende Faktor ist das Aufgeld (Buyer’s Premium), eine Provision, die das Auktionshaus vom Käufer für seine Dienstleistung erhebt.
Dieses Aufgeld ist nicht trivial. Es bewegt sich in der Regel zwischen 25 % und 32 % des Hammerpreises und ist oft degressiv gestaffelt. Das bedeutet, der prozentuale Anteil sinkt bei sehr hohen Zuschlagssummen. Für Ihre Kalkulation als Bieter ist es unerlässlich, dieses Aufgeld von vornherein in Ihr maximales Gebot einzurechnen. Ein Gebot von 10.000 € bedeutet bei 28 % Aufgeld in Wahrheit eine Belastung von 12.800 € – noch vor Steuern und weiteren Kosten.
Die Aufgeldstrukturen der grossen deutschen Auktionshäuser sind zwar ähnlich, unterscheiden sich aber im Detail, wie eine vergleichende Analyse der Gebühren zeigt. Besonders bei Online-Geboten wird oft ein höheres Aufgeld fällig.
| Auktionshaus | Aufgeld bis 800.000€ | Aufgeld über 800.000€ | Online-Aufgeld |
|---|---|---|---|
| Lempertz | 28% | 25% | 30% |
| Van Ham | 27% | 24% | 29% |
| Grisebach | 28% | 23% | 30% |
| Ketterer Kunst | 27% | 22% | 32% |
Zusätzlich zum Aufgeld können weitere Kosten anfallen: die gesetzliche Mehrwertsteuer (entweder auf das Aufgeld oder den Gesamtpreis, je nach Besteuerungsart), das Folgerecht von bis zu 4 % bei Werken lebender oder bis zu 70 Jahre nach ihrem Tod verstorbener Künstler, sowie Kosten für Versand, Versicherung und eventuelle Zollformalitäten. Eine präzise Kalkulation ist daher kein Luxus, sondern Pflicht.
Ihr Aktionsplan: Die vollständigen Auktionskosten berechnen
- Berechnen Sie das Aufgeld basierend auf der degressiven Staffelung des jeweiligen Hauses und addieren Sie es zum potenziellen Hammerpreis.
- Addieren Sie 4% Folgerecht zum Hammerpreis, wenn es sich um Werke lebender oder bis 70 Jahre nach Tod verstorbener Künstler handelt.
- Prüfen Sie, ob die Differenzbesteuerung (MwSt. nur auf Aufgeld und Nebenkosten) oder die Regelbesteuerung (MwSt. auf den Gesamtpreis) Anwendung findet.
- Kalkulieren Sie geschätzte Versand- und Versicherungskosten ein, indem Sie vorab ein Angebot einholen.
- Berücksichtigen Sie mögliche Exportgebühren und Zölle bei Käufen, die über die deutsche Grenze hinausgehen.
Der Rausch des Gefechts: Wie Sie im Bietkrimi einen kühlen Kopf bewahren und nicht zu viel bezahlen
Das Wissen um den „Fluch des Gewinners“ und andere psychologische Fallstricke ist die eine Hälfte der Miete. Die andere ist die Anwendung konkreter Strategien, um diesen Fallen aktiv zu entgehen. Ein kühler Kopf im Bietergefecht ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eiserner Disziplin und eines klaren Schlachtplans. Ihr wichtigstes Werkzeug ist ein absolutes, schriftlich fixiertes Limit, das Sie vor der Auktion auf Basis objektiver Kriterien festlegen – und zwar inklusive aller Nebenkosten.
Seien Sie sich des Anker-Effekts bewusst: Der vom Auktionshaus gesetzte Schätzpreis beeinflusst unbewusst Ihre Zahlungsbereitschaft, selbst wenn Sie ihn für zu hoch oder zu niedrig halten. Ihre eigene Recherche nach vergleichbaren Auktionsergebnissen auf Plattformen wie Artnet oder Artprice ist das beste Gegenmittel, um einen eigenen, unabhängigen Wertanker zu setzen. Wenn das Bieten beginnt, ist es entscheidend, die investierte Zeit und Mühe mental auszublenden. Der Umstand, dass Sie stundenlang recherchiert und auf den Aufruf des Loses gewartet haben, rechtfertigt es nicht, Ihr Limit auch nur um einen Cent zu überschreiten.
Fortgeschrittene Bieter nutzen zudem taktische Manöver. Das „Jump Bidding“, also das Überspringen mehrerer Bietschritte durch ein unerwartet hohes Gebot, kann ein wirksames Mittel sein, um zögerliche Konkurrenten abzuschrecken und Dominanz zu signalisieren. Es durchbricht den Rhythmus und zwingt andere zu einer schnellen Neubewertung. Diese Taktik birgt jedoch das Risiko, den Preis unnötig in die Höhe zu treiben, und sollte mit Bedacht eingesetzt werden. Am Ende ist die stärkste Waffe die Bereitschaft, ohne das Objekt nach Hause zu gehen. Wer nicht verlieren kann, hat bereits verloren.
Strategien gegen Bietfieber und kognitive Verzerrungen
- Setzen Sie vor der Auktion ein absolutes Limit basierend auf objektiven Werteinschätzungen und inklusive aller Nebenkosten.
- Berücksichtigen Sie den Anker-Effekt: Der Schätzpreis beeinflusst unbewusst Ihre Zahlungsbereitschaft; schaffen Sie durch eigene Recherche einen Gegenanker.
- Vermeiden Sie die Sunk-Cost-Fallacy: Die bereits investierte Zeit und Mühe rechtfertigt kein überhöhtes Gebot über Ihr Limit hinaus.
- Nutzen Sie Jump Bidding strategisch: Grosse Gebotssprünge können Konkurrenten verunsichern, bergen aber das Risiko, den Preis selbst zu treiben.
- Bleiben Sie bis zum Ende diszipliniert. Die Fähigkeit, auf ein Objekt zu verzichten, ist Ihre grösste Stärke im Bietergefecht.
Von „Los“ bis „Zuschlag“: Das Auktions-ABC für Einsteiger
Um im Auktionssaal souverän agieren zu können, ist die Kenntnis des spezifischen Vokabulars unerlässlich. Wer die Begriffe versteht, durchschaut auch die Abläufe besser. Das „Los“ bezeichnet schlicht das einzelne Objekt, das zur Versteigerung aufgerufen wird. Der „Aufruf“ ist der Moment, in dem der Auktionator das Los präsentiert und das Bieten mit einem Startpreis eröffnet. Der „Zuschlag“ durch den Hammerschlag besiegelt den rechtsgültigen Kaufvertrag zum Hammerpreis.
Doch zwischen Aufruf und Zuschlag gibt es Feinheiten. Hören Sie den Zusatz „unter Vorbehalt“ (u.V.), bedeutet das, dass das höchste Gebot unter dem geheimen Limit des Einlieferers lag. Der Verkauf ist damit noch nicht gültig. Der Auktionator wird versuchen, mit dem Einlieferer nachzuverhandeln. Für den Bieter entsteht eine Hängepartie. Das Limit selbst ist, wie im Handelsblatt erläutert wird, eine bindende Vereinbarung zwischen Auktionshaus und Verkäufer, die Sicherheit schafft.
Eine weitere, oft diskutierte Praxis ist das sogenannte „Gebot von der Lampe“ oder „chandelier bid“. Damit ist ein fiktives Gebot gemeint, das der Auktionator selbst abgibt, um das Bieten in Gang zu bringen oder auf das Niveau des Limits zu heben. Dies ist in Deutschland bis zum Erreichen des Limits legal und ein übliches Instrument, um eine zögerliche Anfangsphase zu überbrücken. Ein geübtes Auge erkennt es manchmal daran, dass der Auktionator das Gebot ohne klaren Blickkontakt zu einem Bieter im Saal annimmt. Dieses Wissen entmystifiziert den Prozess und hilft Ihnen, die anfängliche Gebotsdynamik richtig einzuschätzen.
Das Wichtigste in Kürze
- Die Preisbildung bei einer Auktion ist eine psychologische Inszenierung, bei der Schätzpreise als strategische Anker dienen.
- Emotionale Bietergefechte führen oft zum „Fluch des Gewinners“, bei dem der Höchstbietende systematisch zu viel bezahlt. Disziplin ist entscheidend.
- Der Hammerpreis ist trügerisch. Das Aufgeld und weitere Gebühren (Folgerecht, MwSt.) machen einen erheblichen Teil der Gesamtkosten aus und müssen vorab einkalkuliert werden.
Der Preis der Schönheit: Wie sich Preise für Antiquitäten bilden
Während bei moderner und zeitgenössischer Kunst oft der Hype und aktuelle Trends eine grosse Rolle spielen, folgt die Preisbildung bei Antiquitäten etablierteren und oft rationaleren Kriterien. Der Preis der Schönheit ist hier weniger eine Frage des subjektiven Geschmacks als vielmehr das Ergebnis einer sorgfältigen Analyse von Fakten. Als Einlieferer oder Käufer von Antiquitäten ist das Verständnis dieser Faktoren entscheidend für eine realistische Werteinschätzung.
Die zentralen Säulen der Preisbildung sind objektivierbar. Die Preisbildung bei Antiquitäten folgt etablierten Marktmechanismen, die auf Faktoren wie Zustand, Seltenheit, Provenienz und nachweisbaren, kürzlich erzielten Verkaufspreisen für vergleichbare Stücke basieren. Ein Biedermeier-Sekretär mit originaler Patina wird auf dem deutschen Markt fast immer einen höheren Preis erzielen als ein perfekt restauriertes Stück, da hiesige Sammler den authentischen Zustand bevorzugen. Vollständigkeit ist ebenfalls ein entscheidender Faktor: Ein komplettes Set aus Augsburger Silber oder eine vollständige Biedermeier-Sitzgruppe kann einen erheblichen Aufpreis gegenüber den Einzelteilen erzielen.
Regionale Präferenzen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Bestimmte Möbeltypen, Manufakturen oder Künstler sind in Süddeutschland gefragter als im Norden – und umgekehrt. Ein erfahrener Experte im Auktionshaus kann diese Marktnuancen einschätzen und die Versteigerung entsprechend terminieren, um sie beispielsweise an aktuelle Einrichtungstrends anzupassen. Eine gut dokumentierte Restaurierung kann den Wert steigern, eine unsachgemässe hingegen kann ihn vernichten. Daher ist Transparenz, untermauert durch Gutachten und Fotodokumentationen, für beide Seiten – Käufer und Verkäufer – von unschätzbarem Wert.
Häufig gestellte Fragen zur Preisbildung bei Auktionen
Was bedeutet ‚unter Vorbehalt‘ (u.V.) bei einem Zuschlag?
Der Auktionator kann ein Objekt unter Vorbehalt zuschlagen, wenn das Gebot unter dem vereinbarten Limit liegt. Der Verkauf ist dann noch nicht endgültig, da die Zustimmung des Einlieferers fehlt. Es beginnt eine Nachverhandlungsphase.
Wie erkenne ich ein ‚Gebot von der Lampe‘?
Achten Sie auf das Verhalten des Auktionators. Ein fiktives Gebot wird oft ohne direkten Blickkontakt zu einem spezifischen Bieter und in gleichmässigen, erwartbaren Steigerungsschritten angenommen. Es dient dazu, das Bieten bis zum Erreichen des Limits anzukurbeln.
Was ist der Unterschied zwischen Schätzpreis und Limit?
Der Schätzpreis ist eine im Katalog veröffentlichte, unverbindliche Preiseinschätzung, die auf Marktdaten basiert und als Orientierung dient. Das Limit (oder der Mindestpreis) ist der vertraulich zwischen Einlieferer und Auktionshaus vereinbarte Mindestpreis, unter dem das Objekt nicht verkauft werden darf.