
Entgegen der Annahme, der Kunstmarkt sei rein kommerziell getrieben, ist das Museum seine unanfechtbare, wertbildende Instanz, die durch wissenschaftliche Kriterien und ethischen Auftrag den Kanon definiert und somit den wahren Wert von Kunst erst schafft.
- Ein Museumsankauf (der „Ritterschlag“) transformiert den Marktwert eines Künstlers nachhaltig und überführt ein Werk in das kulturelle Gedächtnis.
- Die strenge deutsche Museumsethik, insbesondere das Tabu des Sammlungsverkaufs („Deaccessioning“), festigt das Vertrauen in die Institution als ewigen Bewahrer.
Recommandation : Betrachten Sie Ihre Sammlung nicht als isoliertes Investment, sondern als potenziellen Teil eines grösseren, kulturellen Dialogs, dessen Regeln und Werte massgeblich von Museen bestimmt werden.
Als Sammler oder Händler stehen Sie vor einem Kunstwerk und wägen ab: die Signatur des Künstlers, die Strahlkraft der Farben, die lückenlose Provenienz. Sie konsultieren Auktionsergebnisse, Marktanalysen und Expertenmeinungen. All diese Faktoren sind relevant, doch sie kreisen um ein Zentrum, dessen Gravitationskraft oft unterschätzt wird: das Museum. Viele glauben, der Kunstmarkt sei ein freies Spiel von Angebot und Nachfrage, in dem Galerien und Auktionshäuser die Preise bestimmen. Doch dies ist nur die sichtbare Oberfläche eines weitaus komplexeren Ökosystems.
Die wahre, letztinstanzliche Referenz für Qualität, Bedeutung und damit auch für nachhaltigen Wert ist und bleibt die museale Institution. Aus der Perspektive eines Museumsdirektors ist unsere Aufgabe nicht, auf den Markt zu reagieren, sondern ihn durch unsere wissenschaftliche Arbeit und unseren Sammlungsauftrag zu formen. Wir agieren nicht als Käufer unter vielen, sondern als Hüter des kulturellen Gedächtnisses. Die Entscheidung, ein Werk in unsere Sammlung aufzunehmen, es auszustellen oder es für eine wissenschaftliche Untersuchung heranzuziehen, ist mehr als eine Transaktion – es ist ein Urteil über seine Relevanz für die Nachwelt.
Dieser Artikel wird Ihnen einen Einblick hinter die Kulissen gewähren. Er wird die Mechanismen offenlegen, durch die Museen in Deutschland den Status von Kunstwerken definieren, von der alles entscheidenden Akquisition über die ethischen Dilemmata der Restitution bis hin zur besonderen Rolle, die Sie als privater Sammler in diesem Gefüge spielen können. Es geht darum zu verstehen, dass der Dialog mit dem Museum keine Option, sondern eine Notwendigkeit für jeden ist, der sich ernsthaft mit dem Wert von Kunst auseinandersetzt.
Der folgende Beitrag beleuchtet die entscheidenden Facetten der musealen Einflussnahme. Wir werden die Mechanismen von Ankäufen und Leihgaben analysieren, ethische Grundfragen erörtern und aufzeigen, wie Sie als Sammler zum Partner des kulturellen Erbes werden können.
Inhaltsverzeichnis: Die Rolle des Museums als unanfechtbarer Schiedsrichter des Kunstmarktes
- Der Ritterschlag des Museums: Wie ein Ankauf den Marktwert eines Künstlers für immer verändert
- Hinter den Kulissen des Museums: So wird über Ankäufe entschieden und so werden Schätze gelagert
- Ihre Sammlung im Rampenlicht: Die Vor- und Nachteile einer Leihgabe an ein Museum
- Eine Frage der Gerechtigkeit: Die Rolle der Museen bei der Rückgabe von Raubkunst
- Wenn das Museum verkauft: Warum der Verkauf von Sammlungsobjekten in Deutschland ein Tabu ist
- Der Zwilling im Museum: Warum der Vergleich mit gesicherten Stücken so entscheidend ist
- Ausgestellt und publiziert: Wie die Ausstellungsgeschichte den Status eines Kunstwerks beeinflusst
- Mehr als nur Besitz: Wie Sie als privater Sammler zum Bewahrer unseres kulturellen Gedächtnisses werden
Der Ritterschlag des Museums: Wie ein Ankauf den Marktwert eines Künstlers für immer verändert
Ein Kunstwerk mag auf dem freien Markt hohe Preise erzielen, doch sein Eintritt in die Sammlung eines renommierten Museums ist der eigentliche, unumkehrbare Akt der Nobilitierung. Dieser Vorgang, den wir intern oft als „Ritterschlag“ bezeichnen, transzendiert den rein monetären Wert und verleiht dem Werk und seinem Schöpfer eine historische Beständigkeit. Es ist die Bestätigung, dass ein Künstler nicht nur kommerziell erfolgreich, sondern kunsthistorisch relevant ist. Diese Aufnahme in den Kanon hat direkte und nachhaltige Auswirkungen auf den gesamten Markt für die Werke des Künstlers.
Nehmen wir das Beispiel Georg Baselitz, einen der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart. Während seine Werke auf Auktionen regelmässig schwindelerregende Summen erzielen – das teuerste erzielte bei Sotheby’s 11,24 Millionen US-Dollar –, ist seine feste Verankerung in den grossen Museen der Welt die eigentliche Grundlage dieser Bewertung. Die Schenkung von Werken durch den Künstler selbst, wie an die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, ist ein Akt von höchster symbolischer Bedeutung. Sie festigt nicht nur das Vermächtnis des Künstlers, sondern wertet implizit auch jene Werke auf, die sich noch in Privatbesitz befinden.
Für einen Sammler bedeutet dies: Der Wert eines Werks bemisst sich nicht allein am letzten Auktionsergebnis, sondern an seiner Nähe zum musealen Kosmos. Ein Werk aus einer Schaffensphase, die in wichtigen Museumssammlungen vertreten ist, besitzt eine ungleich höhere Stabilität und Wertperspektive. Der Ankauf durch ein Museum ist somit das stärkste Signal, das der Markt erhalten kann – eine dauerhafte Einschreibung in das kulturelle Gedächtnis.
Hinter den Kulissen des Museums: So wird über Ankäufe entschieden und so werden Schätze gelagert
Die Entscheidung über einen Ankauf ist kein schneller kommerzieller Akt, sondern ein tiefgreifender wissenschaftlicher und kuratorischer Prozess. Anders als ein Privatsammler, der spontan aus Leidenschaft kaufen kann, unterliegen öffentliche Häuser in Deutschland einem strengen Reglement und einer besonderen Verantwortung. Unser Handeln wird massgeblich durch den öffentlichen Auftrag und die dafür bereitgestellten Mittel legitimiert; allein die Förderung von Kunst durch den Staat lag in Deutschland im Jahr 2010 bei 9,6 Milliarden Euro. Jeder Ankauf muss daher vor einer Kommission aus internen und externen Experten gerechtfertigt werden.
Hierbei stellen wir uns essenzielle Fragen: Füllt das Werk eine Lücke in unserer Sammlung? Besitzt es eine singuläre kunsthistorische Bedeutung? Ist die Provenienz zweifelsfrei geklärt? Passt es in den langfristigen Sammlungs- und Forschungsschwerpunkt des Hauses? Dieser Prozess kann Monate, manchmal Jahre dauern und involviert intensive Recherchen, kunsttechnologische Analysen und hitzige Debatten. Er ist das genaue Gegenteil eines spekulativen Marktes.
Sobald ein Werk Teil der Sammlung wird, beginnt unsere zweite Kernaufgabe: die Bewahrung für die Ewigkeit. In unseren Depots, die oft den grössten Teil der Museumsfläche ausmachen, herrschen exakt kontrollierte klimatische Bedingungen. Jedes Objekt wird inventarisiert, sein Zustand dokumentiert und von Restauratoren überwacht. Diese oft unsichtbare Arbeit ist das Fundament unserer Existenz.
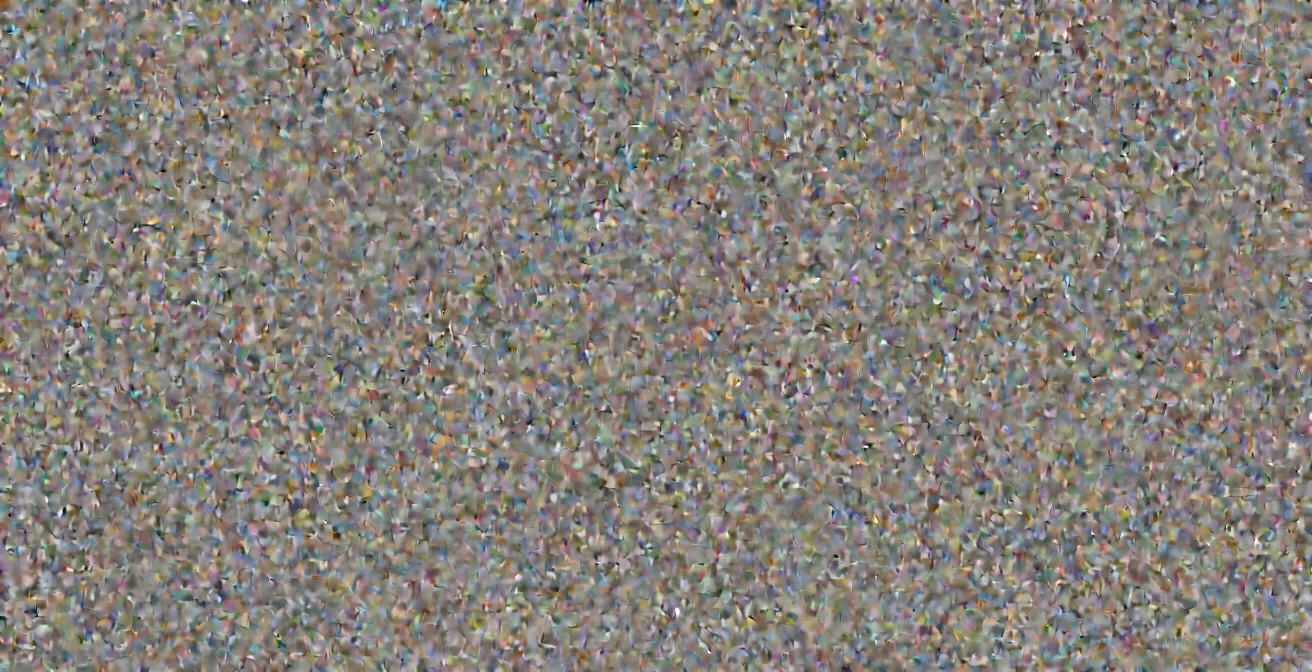
Wie dieses Bild andeutet, ist die Expertise im Umgang mit dem Material entscheidend. Es ist eine Arbeit von höchster Präzision, die sicherstellt, dass die Werke auch in Jahrhunderten noch studiert werden können. Für einen Sammler ist das Wissen um diese konservatorische Sorgfalt ein weiterer Grund, warum ein Werk mit Museumserfahrung eine besondere Aura besitzt: Es wurde nicht nur als bedeutend eingestuft, sondern auch für die Zukunft gesichert.
Ihre Sammlung im Rampenlicht: Die Vor- und Nachteile einer Leihgabe an ein Museum
Für einen privaten Sammler stellt die Leihgabe eines Werkes an ein Museum eine der direktesten und wirkungsvollsten Formen des Dialogs mit der institutionellen Welt dar. Sie kann den Status eines Kunstwerks und einer ganzen Sammlung erheblich steigern, birgt jedoch auch spezifische Herausforderungen. Der entscheidende Vorteil liegt in der öffentlichen Anerkennung und der Wertsteigerung durch Assoziation. Ein Werk, das in einer wichtigen Museumsausstellung gezeigt wird, erhält eine öffentliche Bühne und wird Teil eines kuratierten, kunsthistorischen Narrativs. Seine Provenienz wird um einen prestigeträchtigen Eintrag reicher.
In einigen Bereichen des Kunstmarktes sind es private Leihgeber, die das Programm der Museen massgeblich mitgestalten. Ein prominentes Beispiel in Deutschland ist die von Henri Nannen gegründete Kunsthalle in Emden, die massgeblich auf dem Engagement privater Sammler und Leihgeber beruht. Eine solche Partnerschaft adelt nicht nur das einzelne Werk, sondern die gesamte Sammlung, aus der es stammt. Sie signalisiert dem Markt, dass die Sammlung von musealer Qualität ist.
Die Nachteile sind primär praktischer Natur: Sie verlieren für die Dauer der Leihgabe den direkten Zugriff auf Ihr Werk. Zudem erfordert der Prozess eine erhebliche Vorbereitung, von der Zustandsdokumentation bis zur Aushandlung des Leihvertrags. Die Versicherungswerte müssen exakt festgelegt und der Transport von spezialisierten Kunstspeditionen durchgeführt werden. Doch der Aufwand lohnt sich in der Regel. Der „Nagel zu Nagel“-Versicherungsschutz, den Museen bieten, ist umfassend, und die konservatorische Betreuung während der Ausstellung ist von höchstem Standard.
Ihr Aktionsplan für eine erfolgreiche Museums-Leihgabe
- Dokumentation sicherstellen: Stellen Sie die lückenlose Provenienz und die bisherige Ausstellungshistorie des Werks zusammen.
- Kontakt aufnehmen: Identifizieren Sie den zuständigen Kurator des Zielmuseums und treten Sie mit einem professionellen Exposé an ihn heran.
- Zustand und Wert definieren: Erstellen Sie eine detaillierte Zustandsdokumentation und lassen Sie einen aktuellen Versicherungswert ermitteln.
- Vertrag aushandeln: Bestehen Sie auf einem Leihvertrag mit einer „Nagel zu Nagel“-Versicherung, die das Werk vom Verlassen bis zur Rückkehr an seinen Platz absichert.
- Transport organisieren: Beauftragen Sie eine auf Kunsttransporte spezialisierte Spedition, die die konservatorischen Anforderungen erfüllt.
Eine Leihgabe ist somit eine strategische Entscheidung. Sie ist der Moment, in dem privates Eigentum eine öffentliche Rolle übernimmt und der Sammler zum aktiven Kulturförderer wird. Dieser Schritt festigt nicht nur den Wert, sondern auch die ideelle Bedeutung der eigenen Sammlung.
Eine Frage der Gerechtigkeit: Die Rolle der Museen bei der Rückgabe von Raubkunst
Die dunkelsten Kapitel der Geschichte, insbesondere die Zeit des Nationalsozialismus, haben tiefe Wunden in Sammlungen und Biografien hinterlassen. Für deutsche Museen ist die Auseinandersetzung mit Raubkunst und die proaktive Provenienzforschung daher keine Option, sondern eine zwingende moralische und historische Verpflichtung. Unsere Aufgabe ist es, Licht in die Herkunftsgeschichte unserer Bestände zu bringen und unrechtmässig entzogene Werke an die Erben der rechtmässigen Eigentümer zu restituieren. Dieser Prozess ist komplex, langwierig und oft schmerzhaft, aber er ist das Fundament unserer Glaubwürdigkeit.
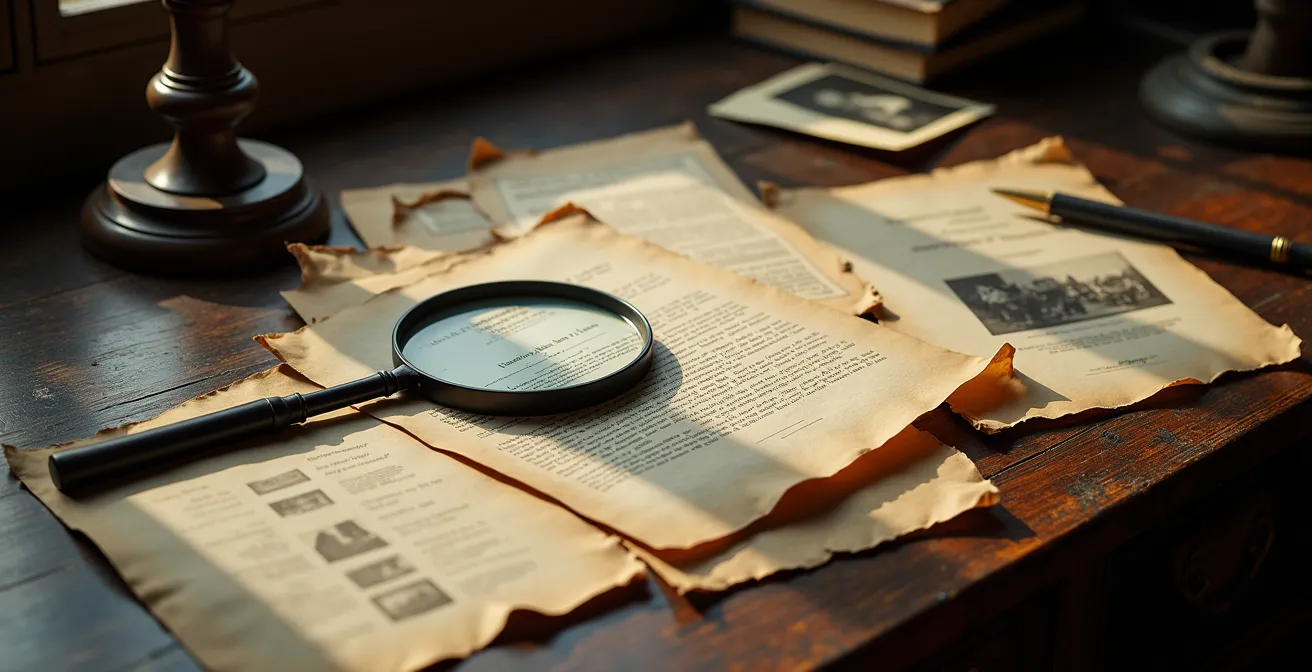
Die akribische Forschungsarbeit in Archiven, wie sie das Bild andeutet, ist entscheidend, um Besitzverhältnisse über Jahrzehnte hinweg zu rekonstruieren. Diese Verantwortung prägt auch unseren Blick auf den Kunstmarkt. Angesichts von Schätzungen, nach denen 40-60% der im Kunsthandel angebotenen Werke gefälscht sein könnten, ist eine lückenlose und saubere Provenienz für uns die oberste Prämisse bei jedem potenziellen Ankauf. Ein Werk mit ungeklärter Herkunft zwischen 1933 und 1945 ist für eine öffentliche Sammlung in Deutschland tabu.
Diese Haltung hat eine direkte Signalwirkung an den Markt: Sie erhöht den Druck auf Auktionshäuser und Galerien, ihre eigene Forschungsarbeit zu intensivieren, und steigert den Wert von Werken mit einwandfreier Provenienz erheblich. Als Sprecher der Staatlichen Museen zu Berlin formulierte es Matthias Henkel treffend:
Unsere Aufgabe ist es, Sammlungen zu erhalten, auf keinen Fall zu veräussern. Zudem entdeckt man manchmal nach Jahren noch richtige Schätze in den Magazinen.
– Matthias Henkel, Sprecher der Staatlichen Museen zu Berlin
Dieses Zitat unterstreicht die Kernphilosophie: Wir sind Bewahrer, nicht Händler. Diese ethische Grundhaltung ist der Anker, der die Institution Museum im oft stürmischen Meer des Kunstmarktes stabilisiert und sie zu einer vertrauenswürdigen Instanz macht.
Wenn das Museum verkauft: Warum der Verkauf von Sammlungsobjekten in Deutschland ein Tabu ist
Der Begriff „Deaccessioning“, also der Verkauf von Objekten aus einer Museumssammlung, ist in der internationalen Debatte präsent, in Deutschland jedoch mit einem tiefen Stigma belegt. Während Museen in den USA gelegentlich Werke veräussern, um mit dem Erlös Neuankäufe zu finanzieren, gilt ein solches Vorgehen hierzulande als fundamentaler Bruch des öffentlichen Auftrags. Der Kern unseres Selbstverständnisses ist das Sammeln, Forschen und Bewahren für die Allgemeinheit und zukünftige Generationen. Ein Verkauf untergräbt dieses Versprechen unwiderruflich.
Die Gründe für diese strikte Haltung sind tief in unserer Kultur- und Geschichtsauffassung verwurzelt. Ein einmal in öffentliches Eigentum überführtes Kulturgut soll dem kommerziellen Kreislauf dauerhaft entzogen sein. Es wird vom Spekulationsobjekt zum Studienobjekt. Ein Verkauf, selbst wenn er gut begründet scheint, öffnet eine Büchse der Pandora: Er setzt das Werk wieder den Launen des Marktes aus und riskiert, dass es in einer privaten Sammlung für immer der Öffentlichkeit unzugänglich wird. Zudem stellt sich die Frage: Nach welchen Kriterien wird entschieden? Was heute als „minder wichtig“ gilt, kann für eine zukünftige Forschergeneration von unschätzbarem Wert sein.
Der Wandel von Kunst zu einem reinen Spekulations- und Investitionsobjekt stellt uns bereits bei Ankäufen vor immense Herausforderungen. Würden Museen selbst beginnen, als Verkäufer aufzutreten, würden sie diese problematische Entwicklung weiter anheizen und ihre eigene Glaubwürdigkeit als unabhängige Instanz verlieren. Die folgende Gegenüberstellung verdeutlicht die unterschiedlichen Philosophien:
Die ethischen Kodizes des Internationalen Museumsrats (ICOM), denen deutsche Museen strikt folgen, sehen einen Verkauf nur in engsten Ausnahmefällen vor, etwa bei Dubletten. Die Debatte zwischen Deutschland und den USA, die eine analyse der unterschiedlichen Museumsethiken aufzeigt, ist hier sehr erhellend.
| Aspekt | Deutschland | USA |
|---|---|---|
| Verkauf von Sammlungsobjekten | Streng reguliert, nur bei Dubletten oder irreparablen Schäden | Häufiger zur Finanzierung von Neuankäufen |
| Ethischer Grundsatz | Öffentlicher Auftrag: Sammeln und Bewahren | Flexiblerer Ansatz, marktorientierter |
| ICOM-Kodex Befolgung | Strikte Einhaltung | Lockerere Interpretation |
Für Sammler ist dieses deutsche Tabu ein Segen. Es garantiert, dass die Referenzobjekte in den Museen verbleiben und als ewiger Massstab für Qualität und Authentizität dienen.
Der Zwilling im Museum: Warum der Vergleich mit gesicherten Stücken so entscheidend ist
In einem Markt, der mit einem Verkaufsvolumen von allein 8,4 Milliarden US-Dollar bei Christie’s im Jahr 2022 eine schier unüberschaubare Menge an Objekten bewegt, ist die Frage der Authentizität von zentraler Bedeutung. Expertenmeinungen und stilistische Analysen sind wichtig, doch die schlagkräftigste Methode zur Echtheitsbestätigung bleibt der direkte Vergleich mit einem gesicherten Referenzstück – dem „Zwilling“ im Museum. Ein Werk, dessen Materialität, Technik und Alterungsprozess über Jahrzehnte in einem Museum dokumentiert und erforscht wurde, dient als unanfechtbarer Massstab.
Wenn ein Sammler oder ein Auktionshaus mit einem ungesicherten Werk an uns herantritt, ist der erste Schritt oft der Abgleich mit den Beständen in unserem Depot. Hier können unsere Kuratoren und Restauratoren unter kontrollierten Bedingungen Vergleiche anstellen, die auf dem freien Markt unmöglich wären. Wir prüfen die Malweise, die Zusammensetzung der Pigmente mittels Röntgenfluoreszenzanalyse, die Grundierung und die Signatur. Jede Abweichung vom gesicherten Museumsbestand wird sofort erkannt. Diese Funktion als letztinstanzliche Referenz ist eine unserer wichtigsten Dienstleistungen für den Erhalt der Integrität des kulturellen Erbes.
Digitale Werkverzeichnisse und Portale wie museum-digital.de haben diesen Prozess vereinfacht, doch sie ersetzen niemals den physischen Vergleich. Die Haptik der Leinwand, der spezifische Craquelé-Sprung im Lack, die Art, wie das Licht aufgetragen wurde – diese subtilen Merkmale sind oft nur im direkten Gegenüber erfassbar. Für einen ambitionierten Sammler ist der Zugang zu dieser Vergleichsmöglichkeit, oft durch die Vermittlung eines anerkannten Experten, der ultimative „Sanity Check“ vor einer grossen Investition. Ein Werk, das diesem Vergleich standhält, hat die höchste Stufe der Authentifizierung erreicht.
Ausgestellt und publiziert: Wie die Ausstellungsgeschichte den Status eines Kunstwerks beeinflusst
Ein Kunstwerk existiert nicht im luftleeren Raum. Sein Wert und seine Bedeutung konstituieren sich auch durch seine Biografie – und die wichtigsten Kapitel dieser Biografie werden in Museen geschrieben. Die Ausstellungshistorie und die Publikationsgeschichte eines Werkes sind nach der Provenienz die bedeutendsten wertbildenden Faktoren. Jede Teilnahme an einer kuratierten Ausstellung und jede Erwähnung in einem wissenschaftlichen Katalog oder einer Monografie festigt seinen Platz im kunsthistorischen Kanon.
Öffentliche Institutionen kommt aufgrund ihrer unabhängigen und fachlichen Expertise eine besondere Deutungshoheit zu. Wenn ein Kurator ein Werk für eine thematische Ausstellung auswählt, signalisiert er damit dessen Relevanz für einen grösseren Diskurs. Das Werk wird aus dem Status eines reinen Objekts gehoben und wird zum Belegstück für eine kunsthistorische These. Dieser Prozess ist eine Form der Adelung, die sich direkt auf die Wahrnehmung und den Marktwert auswirkt. Wie Victor Gisler von der Zürcher Galerie Mai 36 es auf den Punkt bringt:
„Eine Ausstellung an einer renommierten Institution steigert den Marktwert eines Künstlers.“ Diese Aussage aus der Feder eines Händlers bestätigt die Macht, die von unseren Häusern ausgeht. Ein Werk, das durch renommierte Museen gewandert ist, das in wichtigen Katalogen abgebildet und besprochen wurde, erzählt eine Geschichte von Anerkennung und Relevanz. Für einen Sammler ist die Rekonstruktion dieser Ausstellungsgeschichte daher ein entscheidender Teil der Due Diligence. Ein Werk ohne jegliche Ausstellungs- oder Publikationshistorie trägt ein höheres Risiko, als kunsthistorisch marginal eingestuft zu werden, selbst wenn es authentisch ist.
Die Dokumentation dieser „Karriere“ eines Kunstwerks ist somit essenziell. Sie ist der Beweis, dass sich bereits Generationen von Experten mit dem Werk auseinandergesetzt und es für würdig befunden haben, gezeigt und diskutiert zu werden. Es verwandelt ein privates Gut in ein kulturhistorisches Dokument.
Das Wichtigste in Kürze
- Der „Ritterschlag“: Ein Museumsankauf ist die ultimative Wertbestätigung und überführt ein Kunstwerk von einem Marktobjekt in ein dauerhaftes Kulturgut.
- Ethik als Anker: Die strikte deutsche Museumsethik, insbesondere das Tabu des Sammlungsverkaufs, sichert die Rolle des Museums als verlässlicher und ewiger Referenzpunkt.
- Partnerschaft statt Konkurrenz: Ein privater Sammler agiert nicht im luftleeren Raum, sondern im Gravitationsfeld des Museums. Leihgaben und der Dialog mit Kuratoren sind strategische Akte der Wertsteigerung.
Mehr als nur Besitz: Wie Sie als privater Sammler zum Bewahrer unseres kulturellen Gedächtnisses werden
Nachdem wir die Mechanismen der musealen Einflussnahme beleuchtet haben, wird deutlich: Die Beziehung zwischen privatem Sammler und öffentlichem Museum ist keine Konkurrenz, sondern eine Symbiose. In einer Zeit, in der Museen mit explodierenden Marktpreisen zu kämpfen haben, wächst die Bedeutung privater Sammler als Partner bei der Bewahrung unseres kulturellen Erbes. Sie sind nicht nur Investoren, sondern können zu Hütern von Werken werden, die eines Tages vielleicht den Weg in die Öffentlichkeit finden.
Ihre Sammlung ist ein potenzieller Baustein für das kulturelle Gedächtnis von morgen. Indem Sie bei Ihren Akquisitionen ähnliche Kriterien anlegen wie ein Museum – Fokus auf Qualität, lückenlose Provenienz, kunsthistorische Bedeutung –, bauen Sie nicht nur eine wertstabile Sammlung auf, sondern qualifizieren diese für den zukünftigen Dialog mit institutionellen Häusern. Sie werden zu einem verlässlichen Partner für Kuratoren, die stets auf der Suche nach herausragenden Werken für ihre Ausstellungen sind.
Diese verantwortungsvolle Rolle findet ihren Widerhall im grossen öffentlichen Interesse an Kultur. Dass laut einer Hochrechnung rund 30 Millionen Deutsche gelegentlich Museen besuchen, zeigt, dass Kunst kein elitäres Nischenthema ist, sondern ein zentraler Bestandteil unserer Gesellschaft. Ein Sammler, der seine Werke durchdacht auswählt und pflegt, leistet einen Beitrag zu diesem gesamtgesellschaftlichen Dialog. Durch eine Leihgabe, eine Schenkung oder die Unterstützung von Forschungsprojekten kann er aktiv daran mitwirken, Kunst für ein breites Publikum zugänglich zu machen und Wissen zu mehren.
Verstehen Sie Ihre Sammlung daher nicht als Endpunkt, sondern als ein lebendiges Archiv. Pflegen Sie Ihre Dokumentation, forschen Sie zur Geschichte Ihrer Werke und suchen Sie den Austausch mit Experten. Indem Sie die Denkweise eines Kurators adaptieren, sichern Sie nicht nur den materiellen Wert Ihrer Investition, sondern werden zu einem unverzichtbaren Teil des Ökosystems, das unser kulturelles Erbe für die Zukunft bewahrt.
Häufig gestellte Fragen zu Die ultimativen Hüter: Welche Rolle Museen im globalen Antiquitätenhandel spielen
Wie wird der Preis eines Kunstwerks berechnet?
Die Formel lautet: Höhe + Breite mal Künstlerfaktor. Bei Absolventen einer Kunsthochschule liegt dieser Faktor zwischen 5 bis 10.
Warum gibt es keine Rabatte auf Kunstwerke?
Ein Kunstwerk wird niemals günstiger, sondern kann im Preis nur steigen. Rabatte würden eine Demütigung für den Künstler bedeuten und die Glaubwürdigkeit des Galeristen untergraben.
Welche Rolle spielen private Sammler für Museen?
Private Sammler bestimmen als Leihgeber oder Stifter zunehmend, welche Kunst in Museen zu sehen ist und können durch Schenkungen das kulturelle Erbe bewahren.