
Ein geerbtes Objekt wirft oft mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Der Schlüssel zur Klarheit liegt nicht in einer schnellen Online-Schätzung, sondern im Verständnis des methodischen Prozesses eines unabhängigen Experten.
- Die methodische Prüfung durch einen IHK-Sachverständigen garantiert Objektivität und ist oberflächlichen Schätzungen vorzuziehen.
- Der Bewertungskontext ist entscheidend: Der Wert für eine Versicherung (Wiederbeschaffungswert) unterscheidet sich fundamental vom Wert für einen Verkauf (Verkehrswert).
Empfehlung: Beauftragen Sie für eine verlässliche und unparteiische Bewertung immer einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, um den wahren Wert und die Authentizität Ihres Objekts feststellen zu lassen.
Auf dem Dachboden verstaubt ein altes Gemälde, im Keller lagert die Uhrensammlung des Grossvaters und im Wohnzimmer steht ein Biedermeier-Sekretär, der seit Generationen in der Familie ist. Viele Menschen besitzen Objekte, deren wahrer Wert im Verborgenen liegt. Die erste Reaktion ist oft eine schnelle Suche im Internet oder der Besuch einer Fernsehsendung, in der Antiquitäten bewertet werden. Diese Wege liefern jedoch selten mehr als eine vage Ahnung und können im schlimmsten Fall zu kostspieligen Fehlentscheidungen führen.
Die professionelle Wertermittlung ist keine Rateshow, sondern ein methodischer, fast schon forensischer Prozess, der auf Fakten, Erfahrung und objektiven Kriterien beruht. Ein von der Industrie- und Handelskammer (IHK) öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger verfolgt nicht das Ziel, einen möglichst hohen oder niedrigen Preis zu nennen. Seine Aufgabe ist es, die objektive Wahrheit eines Objekts zu ermitteln. Es geht um Authentizität, Herkunft, Zustand und die korrekte Einordnung in den kunsthistorischen und marktwirtschaftlichen Kontext. Dieser Prozess ist die einzige verlässliche Grundlage für Entscheidungen bezüglich Versicherung, Verkauf, Erbteilung oder einfach nur für das beruhigende Wissen um den wahren Wert eines Familienerbstücks.
Dieser Leitfaden führt Sie durch die exakten Schritte einer professionellen Begutachtung. Sie werden verstehen, wie Experten denken, welche Kriterien sie anwenden und warum zwei Gutachten für dasselbe Objekt zu völlig unterschiedlichen, aber dennoch korrekten Ergebnissen führen können. Ziel ist es, Ihnen die notwendige Kompetenz zu vermitteln, um den Prozess der Wertermittlung souverän zu begleiten und die richtigen Fragen zu stellen.
Um Ihnen einen klaren Überblick über die Facetten einer fachkundigen Begutachtung zu geben, gliedert sich dieser Artikel in mehrere logische Abschnitte. Die folgende Übersicht dient Ihnen als Wegweiser durch die Welt der Expertise.
Inhaltsverzeichnis: Das Urteil des Experten: Der genaue Ablauf einer professionellen Kunstbegutachtung
- Vom ersten Blick bis zum Zertifikat: Der genaue Ablauf einer professionellen Kunstbegutachtung
- Vom „Craquelé“ bis zum „Repoussé“: Ein Glossar, das Ihnen hilft, mit Experten auf Augenhöhe zu sprechen
- Kommt der Experte zu mir? Vor- und Nachteile der mobilen Begutachtung im Vergleich zum Auktionshaus
- Was kostet ein gutes Auge? Mit diesen Kosten müssen Sie für ein professionelles Wertgutachten rechnen
- Für die Versicherung oder für den Verkauf? Warum zwei Gutachten für dasselbe Objekt unterschiedlich ausfallen können
- Die Handschrift des Meisters: Wie Sie originale Handwerkstechniken von industrieller Fertigung unterscheiden
- Das Ticken der Zeit: Eine Anleitung zur Bewertung des Zustands antiker Uhren
- Die Jagd nach dem Original: Wie Experten die Echtheit wertvoller Sammlerstücke prüfen
Vom ersten Blick bis zum Zertifikat: Der genaue Ablauf einer professionellen Kunstbegutachtung
Eine professionelle Begutachtung folgt einem strukturierten, mehrstufigen Protokoll, das Subjektivität minimiert und auf nachvollziehbaren Fakten basiert. Der Prozess beginnt lange vor dem eigentlichen Expertentermin. Eine sorgfältige Vorbereitung Ihrerseits kann die Effizienz und Genauigkeit des Gutachtens erheblich steigern. Der erste Kontakt dient der Klärung des Auftrags: Geht es um eine Schätzung für den Verkauf, ein Gutachten für die Versicherung oder eine Bewertung im Rahmen einer Erbauseinandersetzung? Diese Information definiert den Bewertungsmassstab.
Vor Ort untersucht der Sachverständige das Objekt systematisch. Dies umfasst eine visuelle Analyse unter verschiedenen Lichtquellen, um feinste Details, Reparaturen oder Beschädigungen zu erkennen. Die Haptik, das Gewicht und sogar der Klang können erste Hinweise auf Material und Alter geben. Anschliessend folgt die detaillierte Untersuchung der Machart, der Signaturen, Marken oder Punzen. Hierbei kommen oft Hilfsmittel wie Lupen oder UV-Licht zum Einsatz. Parallel dazu erfolgt die Dokumentenprüfung: Gibt es Kaufbelege, frühere Gutachten oder eine dokumentierte Familiengeschichte (Provenienz), die die Herkunft belegen?
Nach der physischen Untersuchung beginnt die Recherche. Der Experte vergleicht das Objekt mit Referenzstücken in Datenbanken, Fachliteratur und Auktionskatalogen. Er analysiert die aktuelle Marktlage für vergleichbare Werke desselben Künstlers, derselben Epoche oder Manufaktur. Erst wenn all diese Puzzleteile zusammengefügt sind, kann der Wert ermittelt werden. Das Ergebnis wird in einem schriftlichen Gutachten festgehalten, das die Beschreibung des Objekts, die Untersuchungsmethoden, die Begründung der Wertermittlung und den festgestellten Wert klar und verständlich dokumentiert. Dieses Zertifikat ist ein offizielles Dokument mit rechtlicher Relevanz.
Fallstudie: Der Weg eines Biedermeier-Sekretärs zum Auktionserfolg
Ein Erbe aus Bayern kontaktierte einen IHK-Sachverständigen wegen einer gerechten Erbaufteilung. Der Experte musste die Kunstgegenstände und Antiquitäten zum Verkehrswert bewerten. Ein Biedermeier-Sekretär wurde nach eingehender Begutachtung der Konstruktionsweise, des Erhaltungszustands und der aktuellen Marktsituation mit einem Verkehrswert von 4.500 Euro bewertet. Dank dieser fundierten Expertise wurde das Möbelstück gezielt einem passenden Auktionshaus zugeführt und nach professioneller Aufbereitung für 5.800 Euro versteigert – ein Erfolg, der auf einer objektiven Bewertung und strategischen Vermarktung beruhte.
Ihr Aktionsplan: Checkliste zur Vorbereitung Ihres Expertentermins
- Objekt fotografieren: Machen Sie bei gutem Tageslicht klare Fotos aus verschiedenen Perspektiven (Vorder-, Rück-, Seitenansicht, Details).
- Dokumente sammeln: Tragen Sie alle verfügbaren Unterlagen wie Kaufbelege, Zertifikate, frühere Gutachten oder Erwähnungen in Familienchroniken zusammen.
- Herkunft notieren: Schreiben Sie alles auf, was Sie über die Geschichte des Objekts wissen (wer war der Vorbesitzer, wann und wo wurde es erworben?).
- Nicht reinigen: Belassen Sie das Objekt im Originalzustand. Patina und Gebrauchsspuren sind wertrelevante Echtheitsmerkmale. Eine unsachgemässe Reinigung kann den Wert erheblich mindern.
- Experten kontaktieren: Wenden Sie sich bei potenziell wertvollen Stücken direkt an einen von der IHK öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das entsprechende Fachgebiet.
Vom „Craquelé“ bis zum „Repoussé“: Ein Glossar, das Ihnen hilft, mit Experten auf Augenhöhe zu sprechen
Die Welt der Kunst und Antiquitäten hat ihre eigene Fachsprache. Das Verständnis einiger Schlüsselbegriffe ermöglicht es Ihnen nicht nur, dem Gutachten eines Experten besser zu folgen, sondern auch die richtigen Fragen zu stellen. Es geht nicht darum, selbst zum Experten zu werden, sondern die Kriterien zu verstehen, die zur Bewertung herangezogen werden. Ein versierter Sachverständiger wird Ihnen diese Begriffe erklären, doch eine gewisse Vorbereitung schafft Vertrauen und eine gemeinsame Basis für das Gespräch.
Viele dieser Begriffe beschreiben materialspezifische Alterungs- oder Herstellungsmerkmale, die für Laien oft wie Mängel aussehen, für Kenner jedoch wichtige Echtheits- und Qualitätsindikatoren sind. Die Fähigkeit, diese Spuren zu „lesen“, ist ein Kernstück der Expertise.

Wie die obige Aufnahme andeutet, offenbart die mikroskopische Betrachtung einer Oberfläche eine Fülle von Informationen. Hier sind einige der wichtigsten Begriffe, die Ihnen bei einer Begutachtung begegnen können:
- Craquelé (oder Krakelee): Dies bezeichnet das feine Netz von Rissen in der Farbschicht eines alten Gemäldes. Ein natürliches Alters-Craquelé entsteht über Jahrzehnte durch die Reaktion der Malschichten auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Da dieses Muster authentischer Alterung kaum perfekt zu fälschen ist, gilt es als wichtiges Echtheitsmerkmal, das den Wert eines Werkes steigern kann.
- Patina: Die Patina ist die über lange Zeit durch natürliche Alterung und Gebrauch entstandene Oberfläche eines Objekts. Bei Metallen kann dies eine Oxidation sein (z.B. Grünspan bei Bronze), bei Holz eine Nachdunklung und Glättung an häufig berührten Stellen. Eine intakte Original-Patina ist ein wertvolles Zeugnis der Geschichte und wird von Sammlern hoch geschätzt.
- Provenienz: Dieser Begriff bezeichnet die lückenlose Herkunftsgeschichte eines Kunstwerks – also die Kette seiner Besitzer von der Entstehung bis heute. Eine gute Provenienz, idealerweise belegt durch Rechnungen, Briefe oder Auktionskataloge, steigert den Wert erheblich. In Deutschland ist die Provenienzforschung besonders im Kontext von NS-Raubkunst von immenser Bedeutung, wobei Datenbanken wie das Art Loss Register bei der Überprüfung helfen.
- Zustand/“Stark restauriert“: Ein Objekt gilt als „stark restauriert“, wenn mehr als ca. 30 % seiner ursprünglichen Substanz ersetzt oder überarbeitet wurden. Solche Eingriffe mindern den Wert oft erheblich, da die historische Authentizität beeinträchtigt ist. Sammler bevorzugen Stücke mit minimalen, fachgerecht durchgeführten Restaurierungen (unter 10-15 %).
Kommt der Experte zu mir? Vor- und Nachteile der mobilen Begutachtung im Vergleich zum Auktionshaus
Eine der ersten praktischen Fragen für den Besitzer von Antiquitäten ist der Ort der Begutachtung. Soll man das wertvolle Erbstück ins Auto packen und zu einem Auktionshaus fahren oder einen Sachverständigen nach Hause bestellen? Beide Optionen haben ihre Berechtigung und richten sich nach Art, Umfang und Wert der zu bewertenden Objekte. Die Entscheidung hängt von Faktoren wie Kosten, Diskretion und Logistik ab.
Die Begutachtung in einem Auktionshaus, oft im Rahmen von „Expertentagen“, ist häufig kostenlos. Dies hat jedoch den Zweck, Objekte für eine kommende Auktion zu akquirieren. Die Schätzung ist daher primär eine Einschätzung des potenziellen Versteigerungserlöses und kein neutrales Gutachten. Zwar können laut Branchenexperten rund 95 % der Antiquitäten vorab online geschätzt werden, doch für ein verbindliches Gutachten ist die physische Prüfung oft unerlässlich. Diese Option eignet sich gut für einzelne, leicht transportable Stücke, bei denen eine Verkaufsabsicht besteht.
Die mobile Expertise durch einen unabhängigen Sachverständigen, der zu Ihnen nach Hause kommt, ist die Methode der Wahl für ganze Sammlungen, Nachlässe oder unbewegliche Objekte wie grosse Möbel oder Standuhren. Hier steht die objektive Wertermittlung im Vordergrund, unabhängig von einer Verkaufsabsicht. Dieser Service ist kostenpflichtig, garantiert aber maximale Diskretion und vermeidet Transportrisiken für Ihre Objekte. Der folgende Vergleich fasst die wesentlichen Unterschiede zusammen.
| Kriterium | Mobile Expertise zu Hause | Begutachtung im Auktionshaus |
|---|---|---|
| Kosten | 130€/Stunde plus Anfahrt (IHK-Sachverständiger) | Oft kostenlos bei Einlieferungsabsicht |
| Geeignet für | Komplette Nachlässe, unbewegliche Objekte (Standuhren, grosse Möbel) | Einzelne transportable Stücke |
| Versicherung | Eigene Hausratversicherung greift | Transportrisiko beim Eigentümer |
| Zeitaufwand | 2-4 Stunden vor Ort | Wartezeiten bei Sprechtagen möglich |
| Vertraulichkeit | Maximale Diskretion gewährleistet | Öffentlicher Rahmen |
Was kostet ein gutes Auge? Mit diesen Kosten müssen Sie für ein professionelles Wertgutachten rechnen
Die Beauftragung eines Experten ist eine Investition in Klarheit und Sicherheit. Die Kosten für ein professionelles Gutachten können stark variieren und hängen von der Art des Gutachtens, dem Fachgebiet und dem Qualifikationsniveau des Sachverständigen ab. Eine „kostenlose Schätzung“ eines Händlers oder Auktionshauses ist in der Regel an ein Verkaufsinteresse geknüpft und daher nicht mit einem unabhängigen, honorarpflichtigen Gutachten zu verwechseln.
Für öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der IHK gibt es etablierte Honorarsätze. Laut dem Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. (BVS) kosten IHK-vereidigte Gutachter durchschnittlich 130,00 € pro Stunde. Zu diesem Stundensatz kommen in der Regel noch Nebenkosten wie Anfahrt, Fotodokumentation und eventuelle Laboruntersuchungen hinzu. Die Dauer einer Begutachtung hängt von der Komplexität und Anzahl der Objekte ab.
Es ist wichtig, zwischen verschiedenen Arten von Gutachten zu unterscheiden, da diese unterschiedlichen rechtlichen Anforderungen und somit auch Kostenstrukturen unterliegen. Eine einfache Wertindikation ist naturgemäss günstiger als ein ausführliches, gerichtsfestes Gutachten für eine Erbauseinandersetzung. Ein seriöser Sachverständiger wird Ihnen vorab immer eine transparente Kostenschätzung auf Basis des zu erwartenden Aufwands unterbreiten. Die folgende Übersicht gibt Ihnen eine Orientierung über die gängigen Kostenmodelle:
- Private Gutachten: Der Stundensatz für Privatgutachten zur persönlichen Information oder für Versicherungszwecke liegt je nach Sachgebiet meist zwischen 100 und 250 Euro.
- Gerichtsgutachten: Wird ein Gutachten von einem Gericht angeordnet (z.B. in Erb- oder Scheidungsfällen), richtet sich die Vergütung nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) und ist oft niedriger (ca. 50-95 Euro/Stunde).
- Versicherungsgutachten: Manchmal wird das Honorar auch prozentual vom ermittelten Versicherungswert berechnet, üblich sind hier Sätze zwischen 0,5 % und 2 %.
- Online-Kurzexpertisen: Für eine erste, unverbindliche Einschätzung bieten diverse Online-Plattformen Pauschalen an, die oft bei unter 50 Euro beginnen. Diese ersetzen jedoch kein vollwertiges Gutachten.
Für die Versicherung oder für den Verkauf? Warum zwei Gutachten für dasselbe Objekt unterschiedlich ausfallen können
Eines der grössten Missverständnisse bei der Bewertung von Kunst und Antiquitäten ist die Annahme, ein Objekt habe *einen* einzigen, festen Wert. Tatsächlich kann der Wert desselben Gegenstandes je nach Zweck des Gutachtens erheblich variieren. Ein öffentlich bestellter Sachverständiger ermittelt daher nicht „den Wert“, sondern den Wert in einem bestimmten Bewertungskontext. Die beiden wichtigsten Kontexte sind der Versicherungswert und der Verkehrswert.
Der Wiederbeschaffungswert (oder Versicherungswert) beziffert die Summe, die aufgewendet werden müsste, um ein gleichartiges und gleichwertiges Objekt innerhalb einer angemessenen Frist am Kunstmarkt oder im Fachhandel wiederzubeschaffen. Dieser Wert liegt in der Regel deutlich höher, da er die Händlermarge, Suchkosten und die Verfügbarkeit am Markt berücksichtigt. Er dient als Grundlage für Ihre Hausrat- oder Kunstversicherung, um im Schadensfall (Diebstahl, Brand) einen adäquaten Ersatz zu gewährleisten.
Der Verkehrswert (oder Marktwert) hingegen ist der Preis, der bei einem Verkauf des Objekts zum Bewertungszeitpunkt unter gewöhnlichen Marktbedingungen voraussichtlich zu erzielen wäre. Dieser Wert ist die relevante Grösse für Erbauseinandersetzungen, Schenkungen oder die Planung eines Verkaufs. Er ist typischerweise niedriger als der Wiederbeschaffungswert, da er potenzielle Verkaufskosten oder Händlerrabatte bereits gedanklich einpreist. Wie eine juristische Analyse im Berliner Anwaltsblatt zeigt, führt dieser Unterschied oft zu Enttäuschungen bei Erben, die von einem viel höheren Wert ausgegangen sind, wie eine Fallstudie verdeutlicht.
Fallstudie: Wiederbeschaffungswert vs. Verkehrswert am Beispiel einer Barock-Kommode
Eine geerbte Barock-Kommode wird für die Hausratversicherung begutachtet. Der Experte ermittelt einen Wiederbeschaffungswert von 12.000 Euro. Dies ist die Summe, die benötigt würde, um eine vergleichbare Kommode bei einem spezialisierten Antiquitätenhändler zu erwerben. Einige Monate später soll die Kommode im Rahmen einer Erbteilung bewertet werden. Hierfür wird der Verkehrswert ermittelt, der bei 6.500 Euro liegt. Dieser Wert reflektiert den realistisch erzielbaren Preis bei einer Veräusserung, beispielsweise über ein Auktionshaus. Beide Bewertungen sind korrekt, denn sie beantworten zwei völlig unterschiedliche Fragestellungen.
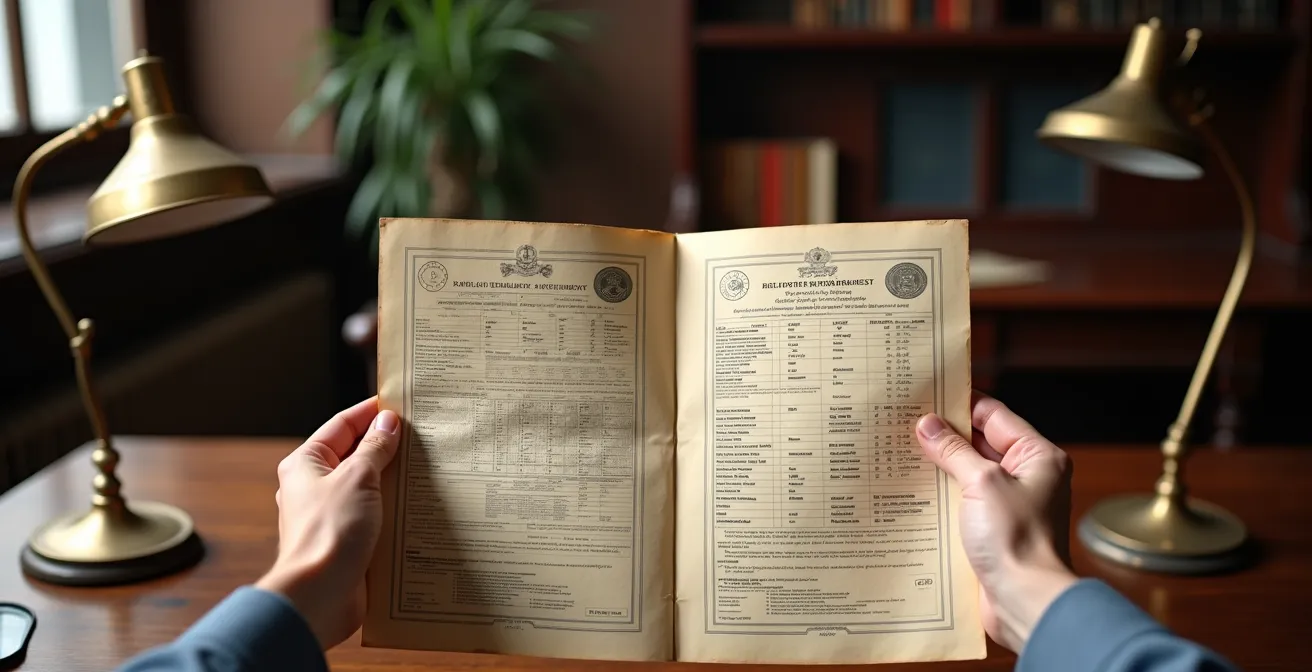
Die Handschrift des Meisters: Wie Sie originale Handwerkstechniken von industrieller Fertigung unterscheiden
Die Fähigkeit, authentisches Handwerk von einer maschinellen Reproduktion zu unterscheiden, ist eine der Kernkompetenzen eines Sachverständigen. Es ist eine Form der „Spurensicherung“, bei der nach den subtilen Zeichen gesucht wird, die eine menschliche Hand im Gegensatz zu einer Maschine hinterlässt. Während eine Fälschung oft auf den ersten Blick perfekt erscheint, verrät sie sich bei genauerer Betrachtung durch ihre zu grosse Perfektion und das Fehlen charakteristischer „Unregelmässigkeiten“.
Ein IHK-Sachverständiger muss fundierte Kenntnisse über historische Herstellungstechniken in verschiedensten Bereichen wie Möbel, Porzellan, Silber oder Gemälde nachweisen. Anhand dieser Kenntnisse kann er die „Handschrift“ einer Epoche oder eines bestimmten Meisters identifizieren. Bei antiken Möbeln sind es oft die nicht sichtbaren Teile, die die Wahrheit offenbaren.
Ein gutes Beispiel sind Biedermeier-Möbel: Ein originales Stück weist an den Unterseiten von Schubladen oder an der Rückwand oft unregelmässige Hobelspuren auf, die vom Handhobel stammen. Eine moderne Kopie hingegen hat hier perfekt glatte, maschinell gefräste Oberflächen. Ebenso ist die berühmte Schellackpolitur, die in vielen Schichten von Hand aufgetragen wurde, in ihrer Tiefe und Lebendigkeit kaum maschinell nachzuahmen. Über Jahrzehnte entwickelt sie eine einzigartige Patina, die von Kennern hoch geschätzt wird.
Bei Porzellan achtet der Experte auf die Art der Bemalung (unter oder auf der Glasur), die Präzision der Pinselstriche und die Qualität der Manufakturmarke. Eine gestempelte Marke einer industriellen Fertigung unterscheidet sich deutlich von einer handgemalten Marke aus dem 18. Jahrhundert. Diese Details sind für den Laien kaum erkennbar, für den Experten jedoch klare Indizien. Wie der renommierte Sachverständige Dr. Frithjof Hampel in einem Vortrag treffend bemerkte, ist der Prozess oft eliminatorisch, wie er in einer Publikation für das Berliner Anwaltsblatt erklärt:
Insgesamt ist es wesentlich einfacher, eine Fälschung zu erkennen, als die Echtheit eines Kunstwerkes festzustellen.
– Dr. Frithjof Hampel, Berliner Anwaltsblatt, Vortrag zu Kunstbewertungen
Das Ticken der Zeit: Eine Anleitung zur Bewertung des Zustands antiker Uhren
Antike Uhren sind faszinierende Objekte, da sie sowohl Kunsthandwerk als auch feinmechanische Präzisionsinstrumente sind. Ihre Bewertung ist daher besonders komplex und erfordert Expertise in beiden Bereichen. Neben Marke, Modell und Seltenheit ist der Zustand der entscheidende Wertfaktor. Hierbei gilt die Regel: Originalität vor Perfektion. Eine unsachgemässe Restaurierung kann den Wert einer seltenen Uhr vernichten.
Der Sachverständige prüft sowohl das Äussere (Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger) als auch das Innere (das Uhrwerk). Korrosion am Gehäuse, Haarrisse im Emaille-Zifferblatt oder ersetzte Zeiger mindern den Wert. Besonders wichtig ist die Originalität des Zifferblatts; eine authentische Patina ist oft wertvoller als ein neu lackiertes oder „restauriertes“ Zifferblatt. Im Inneren wird das Uhrwerk auf Originalteile, Reparaturen und seine Funktionsfähigkeit geprüft. Die Ganggenauigkeit über 24 Stunden gibt einen guten Hinweis auf den allgemeinen Zustand des Werks.
Erfahrung eines Sammlers mit einer A. Lange & Söhne Taschenuhr
Ein Sammler aus Dresden liess seine geerbte A. Lange & Söhne Taschenuhr von 1924 begutachten. Der IHK-Sachverständige identifizierte anhand der Werksnummer und des originalen Stammbuchauszugs die Echtheit. Trotz eines reparierten Haarrisses im Zifferblatt wurde die Uhr aufgrund ihrer Seltenheit und des kompletten „Full Sets“ (Originalbox und Papiere) mit 18.000 Euro bewertet – der dreifache Wert einer vergleichbaren Uhr ohne die vollständigen Originaldokumente.
Wie dieses Beispiel zeigt, sind Vollständigkeit und Dokumentation extrem wertsteigernd. Ein sogenanntes „Full Set“ mit Originalschlüssel, Box und Papieren kann den Wert einer Uhr um bis zu 40 % erhöhen. Die folgende Checkliste hilft Ihnen bei einer ersten eigenen Einschätzung.
Ihr Aktionsplan: Checkliste zur Erstbewertung antiker Uhren
- Sichtbare Korrosion prüfen: Untersuchen Sie Gehäuse und Zifferblatt auf Spuren von Rost oder Grünspan. Dies sind Alterungsspuren, die den Zustand beeinträchtigen.
- Originalität des Zifferblatts kontrollieren: Suchen Sie nach Anzeichen für eine Neulackierung oder Reparatur. Eine gleichmässige, feine Patina ist oft ein Zeichen für Originalität und wird von Sammlern bevorzugt.
- Punzen und Marken dokumentieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Herstellermarken, Seriennummern oder Edelmetallpunzen mit einer Makrofunktion.
- Ganggenauigkeit notieren: Ziehen Sie die Uhr (sofern funktionstüchtig) vollständig auf und notieren Sie die Abweichung der Zeit nach 24 Stunden. Eine Abweichung von unter zwei Minuten deutet auf einen guten Zustand hin.
- Vollständigkeit prüfen: Suchen Sie nach Zubehör wie dem Originalschlüssel, der Originalbox oder den Kaufpapieren. Diese Elemente können den Wert erheblich steigern.
Das Wichtigste in Kürze
- Die Objektivität eines unabhängigen, IHK-vereidigten Sachverständigen ist wertvoller als eine schnelle, kostenlose Schätzung, die oft an ein Verkaufsinteresse geknüpft ist.
- Der Bewertungskontext ist entscheidend: Der hohe Wiederbeschaffungswert für die Versicherung ist nicht mit dem niedrigeren Verkehrswert für einen Verkauf oder eine Erbteilung identisch.
- Die lückenlose Dokumentation (Provenienz), Originalpapiere und der Originalzustand (Patina) sind oft die grössten Wertmultiplikatoren, besonders bei Uhren und Kunstwerken.
Die Jagd nach dem Original: Wie Experten die Echtheit wertvoller Sammlerstücke prüfen
Die vielleicht wichtigste und schwierigste Aufgabe eines Sachverständigen ist die Echtheitsprüfung. Sie ist die Grundlage jeder weiteren Bewertung. Dieser Prozess ist detektivische Feinarbeit, die auf einer Kombination aus kunsthistorischem Wissen, materialtechnischer Analyse und langjähriger Erfahrung beruht. Ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger bürgt mit seinem Namen und seinem Eid für die Richtigkeit seiner Aussage. Dieser Eid unterstreicht die enorme Verantwortung und das erforderliche Mass an Objektivität, wie es die Sachverständigenordnung der IHK vorschreibt.
Der Sachverständige hat einen Eid zu leisten, wonach er seine Sachverständigentätigkeit unabhängig, weisungsfrei, persönlich und unparteiisch ausführt und seine Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen erstattet.
– IHK Berlin, Sachverständigenordnung
Die Prüfung erfolgt auf mehreren Ebenen. Zuerst die stilistische Analyse: Passt das Werk in die Schaffensperiode des Künstlers? Entsprechen Komposition, Farbpalette und Motivik seinem bekannten Stil? Kleinste Abweichungen können bereits ein Warnsignal sein. Danach folgt die materialtechnische Untersuchung. Handelt es sich um eine Leinwand aus der richtigen Epoche? Wurden Pigmente verwendet, die zur Zeit der Entstehung bereits verfügbar waren? UV-Licht kann hier spätere Übermalungen oder Restaurierungen sichtbar machen, die mit blossem Auge unsichtbar sind.
Ein entscheidender Punkt ist die bereits erwähnte Provenienzforschung. Kann der Weg des Objekts durch die Zeit nachverfolgt werden? Existieren Einträge in alten Auktionskatalogen, Erwähnungen in der Fachliteratur oder Ausstellungsnachweise? Eine lückenlose Herkunftsgeschichte ist oft der stärkste Beweis für die Echtheit. Letztlich ist es die Synthese all dieser Einzeluntersuchungen, die zu einem fundierten Urteil führt. Es gibt selten den einen, ultimativen Beweis. Vielmehr ist es die Stimmigkeit der gesamten Indizienkette, die den Experten zur Überzeugung von der Echtheit – oder der Fälschung – eines Objekts bringt.
Um den Wert Ihres Erbstücks fundiert und objektiv ermitteln zu lassen, besteht der nächste logische Schritt darin, einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der IHK in Ihrer Nähe zu konsultieren. Nur so erhalten Sie eine verlässliche Grundlage für all Ihre weiteren Entscheidungen.
Häufige Fragen zu Das Urteil des Experten: So läuft eine professionelle Begutachtung Ihrer Antiquitäten ab
Was bedeutet ‚Alters-Craquelé‘ und warum erhöht es den Wert?
Ein Alters-Craquelé bezeichnet natürliche Risse in der Malschicht eines Gemäldes, die über Jahrzehnte durch Temperaturschwankungen entstehen. Diese authentischen Alterungsspuren sind nahezu unmöglich perfekt zu fälschen und gelten daher als wichtiges Echtheitsmerkmal, das den Wert steigert.
Wann spricht man von ’stark restauriert‘ und was bedeutet das für den Wert?
Als ’stark restauriert‘ gilt ein Objekt, wenn mehr als 30% der Originalsubstanz ersetzt oder überarbeitet wurde. Dies mindert den Wert erheblich, da die Authentizität und der historische Charakter beeinträchtigt sind. Sammler bevorzugen Stücke mit maximal 10-15% Restaurierungsanteil.
Was versteht man unter ‚Provenienz‘ und warum ist sie in Deutschland besonders wichtig?
Die Provenienz bezeichnet die lückenlose Herkunftsgeschichte eines Kunstwerks. In Deutschland ist dies besonders wichtig im Kontext von ‚Raubkunst‘ – hierfür hilft das Art Loss Register, eine internationale Datenbank verlorener und gestohlener Kunstwerke, bei der Überprüfung der Herkunft.